Made in Dresden
 Es wird hier nicht um die gehen, die sich redlich bemühen in ihrem Leben zurecht zu kommen und sich dabei auch mit dem Buddhismus beschäftigen. Es geht hier um diejenigen die die Deutungshoheit über Buddhismus beanspruchen. Dabei geht es auch um die Frage ob man das Erbe buddhistischer Kultur eigentlich denen überlassen will, die mit ihm ein gutes Geschäft machen. Ein gutes Geschäft nicht nur mit der direkten Umsetzung buddhistischer oder pseudobuddhistischer Gedanken in Geldwert – wie das Verlage tun die den Markt mit esoterischer Billigwahre überschwemmen, die zwecks besseren Verkaufs immer irgendwas mit „Buddha“ im Titel führt – sondern auch mit der Umsetzung dieser Gedanken in narzisstisches Vermögen. Narzisstisches Vermögen, das es ermöglicht sich Wertschätzung zu erkaufen und damit den sozialen Status quo zu erhöhen.
Es wird hier nicht um die gehen, die sich redlich bemühen in ihrem Leben zurecht zu kommen und sich dabei auch mit dem Buddhismus beschäftigen. Es geht hier um diejenigen die die Deutungshoheit über Buddhismus beanspruchen. Dabei geht es auch um die Frage ob man das Erbe buddhistischer Kultur eigentlich denen überlassen will, die mit ihm ein gutes Geschäft machen. Ein gutes Geschäft nicht nur mit der direkten Umsetzung buddhistischer oder pseudobuddhistischer Gedanken in Geldwert – wie das Verlage tun die den Markt mit esoterischer Billigwahre überschwemmen, die zwecks besseren Verkaufs immer irgendwas mit „Buddha“ im Titel führt – sondern auch mit der Umsetzung dieser Gedanken in narzisstisches Vermögen. Narzisstisches Vermögen, das es ermöglicht sich Wertschätzung zu erkaufen und damit den sozialen Status quo zu erhöhen.
Dieses Vermögen wird wie jedes Geldvermögen in einer Währung beziffert. Dabei ist es wichtig zu sehen, daß Geldvermögen wie narzisstisches Vermögen Ausdruck bestimmter Formen sozialer Beziehungen sind, bzw. der Fähigkeit diese zu stiften, zu manipulieren und auszubeuten. Der Kapitalist besitzt Produktionsmittel die es ihm ermöglichen mit anderen, die dieses Mittel nicht besitzen, eine bestimmte soziale Beziehung einzugehen – die der Ausbeutung. In der gleichen Weise verfügt der X-Buddhist in gehobener Stellung über Produktionsmittel die ihm bestimmte Formen der Interaktion ermöglichen. Diese Produktionsmittel bestehen z.B. aus speziellen Ritualen, Termini, Zeichen, aus spezieller Kleidung und Haartracht, aus heiligen Gegenständen, geweihten Räumen, aus Zugehörigkeit zu anerkannten Meistern und nicht zuletzt aus Meditation. Es handelt sich dabei um einen symbolischen Raum und der X-Buddhist trachtet nach dem Erwerb, der Vermehrung und Vermarktung dieser Güter und der Sicherung des symbolischen Raumes den sie konstituieren.
 Beispiele für die Angabe der Größe des narzistischen Vermögens des X-Buddhisten sind z.B. stereotype Aussagen darüber wie lange man schon meditierte, wie lange man sich mit Buddhismus beschäftigte, wie lange man bei diesem oder jenem Meister weilte, bei wievielen Meistern man weilte, ob diese einen zu lehren beauftragten, daß man diese oder jene Weihe empfing und vieles mehr. Man findet diese Angaben ausnahmslos in der Vita eines jeden X-Buddhisten. Man ist ordiniert, autorisiert oder inspiriert, ohne daß aus diesen Angaben ersichtlich würde, welchen materiellen Wert diese Angaben eigentlich haben – wobei „materiell“ hier fassbar, immanent, sichtbar meint. Der Wert solcher Angaben ist anscheinend selbstverständlich, sozusagen naturgegeben – wie der Geldwert. Aber genau wie der Wert einer Währung, der mehr oder weniger willkürlich festgelegt wird, indem bestimmte Posten in seine Berechnung einfliessen und andere weggelassen werden, ist auch diese Dharmawährung ein Idee die auf einer Entscheidung beruht was in die Berechnung einzufliessen hat und was nicht.
Beispiele für die Angabe der Größe des narzistischen Vermögens des X-Buddhisten sind z.B. stereotype Aussagen darüber wie lange man schon meditierte, wie lange man sich mit Buddhismus beschäftigte, wie lange man bei diesem oder jenem Meister weilte, bei wievielen Meistern man weilte, ob diese einen zu lehren beauftragten, daß man diese oder jene Weihe empfing und vieles mehr. Man findet diese Angaben ausnahmslos in der Vita eines jeden X-Buddhisten. Man ist ordiniert, autorisiert oder inspiriert, ohne daß aus diesen Angaben ersichtlich würde, welchen materiellen Wert diese Angaben eigentlich haben – wobei „materiell“ hier fassbar, immanent, sichtbar meint. Der Wert solcher Angaben ist anscheinend selbstverständlich, sozusagen naturgegeben – wie der Geldwert. Aber genau wie der Wert einer Währung, der mehr oder weniger willkürlich festgelegt wird, indem bestimmte Posten in seine Berechnung einfliessen und andere weggelassen werden, ist auch diese Dharmawährung ein Idee die auf einer Entscheidung beruht was in die Berechnung einzufliessen hat und was nicht.
In jedem Fall gibt es feste Bezugsgrößen an denen sich der Wert einer Währung orientiert – sie ist mit einem bestimmten realen Wert „unterlegt“ ohne den sie nichts wäre und für den sie nur Platzhalter ist. In die volkswirtschaftliche Berechnung des Geldwertes fliessen z.B. Waren und Dienstleistungen ein. In der spirituellen Währung um die man im X-Buddhismus feilscht, ist es eine Geheime Magische Essenz die ihr unterlegt ist.
Man muss von der Existenz dieser Essenz ausgehen, da es etwas geben muss was Kleidungsstücken, Handlungen, Gesten und Zeichen im religiösen Bereich, ganz allgemein allen religiösen Symbolen, die ansonsten beliebig austauschbar wären, einen bestimmten Stellenwert verleiht, so daß sie unersetzlich werden. Der Verweis auf ein solches Symbol und die Auskunft man habe bestimmte Investitionen geleistet um es zu besitzen – Zuflucht, Retreat, Eintritt in eine Linie, bedingungsloser Gehorsam einem Lehrer gegenüber – d.h. um es für sich in Anspruch nehmen zu können, sind Beleg für den Besitzt der Essenz.
Eine Priesterweihe beispielsweise ist das Diplom welches ausweist, daß der Priester die magische Essenz besitzt. Da dem Uneingeweihten diese Essenz nicht sichtbar ist, ist das Diplom unabdingbar. Wie aber lässt sich der Wert des Diploms überprüfen? Das Diplom der Priesterweihe hat ja nur den Wert den die Geheime Magische Essenz angeblich hat. Beides bezieht sich aufeinander. Was von diesen dreien aber – Essenz, Diplom, Mensch – allein sichtbar bleibt, ist die materielle Handlung. Immanentes Sein nicht transzendentaler Schein. Letztlich gibt es nur die Handlung des Priesters.
 Das heisst, auch der Status quo innerhalb des sozialen Beziehungen, kann sich eigentlich nur aus dieser Immanenz herleiten. Ebenso bemisst sich der Wert des Diploms, also der Priesterweihe, nur aus ihr. De facto ist die Beziehung zwischen Diplom und Status quo eine fiktive wenn das Diplom seinen Wert nicht aus der materiellen Handlung des Betreffenden bezieht. Das heisst das Wertpapier Priesterweihe hat tatsächlich nur den Wert den die eigentlichen Produktionsmittel, die materiellen Handlungen, erzeugen können. Damit ist man schon bei der Einsicht, daß jegliche Weihe nur aus Handlung bestehen kann und jegliches Wertpapier überflüssig wird.
Das heisst, auch der Status quo innerhalb des sozialen Beziehungen, kann sich eigentlich nur aus dieser Immanenz herleiten. Ebenso bemisst sich der Wert des Diploms, also der Priesterweihe, nur aus ihr. De facto ist die Beziehung zwischen Diplom und Status quo eine fiktive wenn das Diplom seinen Wert nicht aus der materiellen Handlung des Betreffenden bezieht. Das heisst das Wertpapier Priesterweihe hat tatsächlich nur den Wert den die eigentlichen Produktionsmittel, die materiellen Handlungen, erzeugen können. Damit ist man schon bei der Einsicht, daß jegliche Weihe nur aus Handlung bestehen kann und jegliches Wertpapier überflüssig wird.
Der Zirkus der Zirkularität
Nun lässt sich anhand eines aktuellen Beispiels zeigen, daß produktive Handlungen einfach darin bestehen können zu behaupten ein Wertpapier habe einen bestimmten Wert, daß sie also darin bestehen können einen transzendentalen Schein zu produzieren. Wenn aber der Status quo eines buddhistischen Priesters oder einer buddhistischen Institution auf dem Wert eines Wertpapiers beruht, der Status quo aber eingesetzt wird um den Wert des Wertpapiers zu erhalten, befinden wir uns in einer Endlosschleife aus zwei Instanzen die sich gegenseitig definieren.
Wenn den unerleuchteten Aspiranten, den Suchenden, denen die aus einem Leben im Falschen ausbrechen wollen, vorgespiegelt wird, daß die priesterliche Macht der Institution von jenseits dieser Zirkularität stammt, also aus der Geheimen Magischen Essenz, dann ist gerade das das Falsche von dem man sich befreien will. Die zirkuläre Produktion von Bedeutung dient also der Aufrechterhaltung einer Täuschung und buddhistische Institutionen die eine solche Täuschung aufrecht erhalten handeln diametral entgegen ihrem eigentlichen Ziel: Befreiung aus Samsara. Befreiung gedacht als Aufdeckung falscher, unvollständiger oder irreführender Vorstellungen über das was existiert, über sein Zustandekommen und seine Zusammenhänge – kurz und schlicht: Verständnis bedingten Entstehens.
 Eine buddhistische Institution existiert tatsächlich nur in ihren immanenten materiellen Handlungen, nicht durch transzendentale Verankerungen. Die Setzung einer transzendentalen Verankerung, die durchaus möglich und auch wirksam ist, erzeugt eine Fiktion – aber als solche gesehen bleibt sie immer ein immanenter Akt. Allerdings wird diese Verankerung, wenn es darum geht die Fiktion als real auszuweisen, durch ein religiöses Symbol als Verweis auf die Geheime Magische Essenz verschleiert. Das ist der Zirkus der Zirkularität: Eine Fiktion aus zwei Komponenten die sich gegenseitige stützen, die durch den transzendentalen Anker als naturgegeben wirkt, die tatsächlich aber eine Illusion ist. Die Aufgabe der Kritik ist es den Mechanismus sichtbar zu machen der diese Illusione erzeugt.
Eine buddhistische Institution existiert tatsächlich nur in ihren immanenten materiellen Handlungen, nicht durch transzendentale Verankerungen. Die Setzung einer transzendentalen Verankerung, die durchaus möglich und auch wirksam ist, erzeugt eine Fiktion – aber als solche gesehen bleibt sie immer ein immanenter Akt. Allerdings wird diese Verankerung, wenn es darum geht die Fiktion als real auszuweisen, durch ein religiöses Symbol als Verweis auf die Geheime Magische Essenz verschleiert. Das ist der Zirkus der Zirkularität: Eine Fiktion aus zwei Komponenten die sich gegenseitige stützen, die durch den transzendentalen Anker als naturgegeben wirkt, die tatsächlich aber eine Illusion ist. Die Aufgabe der Kritik ist es den Mechanismus sichtbar zu machen der diese Illusione erzeugt.
Die Metapher vom Zirkus könnte zu der Vorstellung einer hell erleuchteten Manege verleiten, in der ein Magier seine Vorführung darbietet und von Zuschauern, die von ausserhalb, von den Rängen und aus dem Dunkel das Geschehen beobachten (und den Trick entschlüsseln). Die tatsächlichen Mechanismen die x-buddhistische Magier anwenden, haben aber zwei Qualitäten die sie vom Magier der Manege unterscheiden: Sie glauben selbst an die Realität ihres Zaubers und wir als Kritiker können uns nicht wirklich ausserhalb ihres Zirkels stellen. Wir können lediglich indem wir einem sichtbar werdenden Widerspruch nicht ausweichen, die ursprüngliche Illusion als nicht mehr haltbar erkennen und unseren Standpunkt verschieben indem wir beginnen zu fragen was da vor sich geht. D.h. wir beginnen bewusst eine andere Transzendenz aufzubauen die unsere Immanenz verschiebt. Wir halluzinieren immer noch, nun aber mit dem Bewusstsein zu halluzinieren. Das unterscheidet uns von den x-buddhistischen Magiern die ihre Halluzination für das Reale halten.
Der gestürzte Buddha vom Viktualienmarkt
Das Beispiel an dem man die x-buddhistische Illusion exemplarisch sichtbar machen kann, also den ökonomischen Mechanismus der Produktion illusionärer Bedeutung, ist eine gestürzte Buddhafigur auf dem Münchner Viktualienmarkt. Auf der durch den Umsturz sichtbar  werdenden Bodenplatte steht „Made in Dresden„.
werdenden Bodenplatte steht „Made in Dresden„.
Am Viktualienmarkt, an dem Menschen und Warenströme aus aller Welt zusammentreffen, platziert [der Malaysier Han Chon] einen Buddha als überdimensionalen Souvenirartikel. Mittlerweile zu einem Dekorationsartikel fern des spirituellen Kontexts geworden, steht die Figur für die Frage nach Authentizität. Sie ist – wie zahlreiche Asiatica auf dem europäischen Markt – nicht in Asien hergestellt worden, sondern „Made in Dresden“. (Quelle)
So beschreibt das Münchner Kulturreferat die Installation die im Rahmen von A Space Called Public / Hoffentlich Öffentlich zu sehen ist. Zur allgemeinen Idee dieses Projektes, das eine ganze Reihe von Installationen, Performances und Skulpturen beinhaltet, schreibt das Kulturreferat:
Der öffentliche Stadtraum [kann] auch und vielleicht gerade in unserem digitalen Zeitalter als Bezugs- und Mittelpunkt für den Austausch von Ideen dienen. Hier mischen sich gemeinschaftliche sowie unterschiedliche, manchmal auch höchst gegensätzliche Interessen, verbinden sich Nostalgie und Hoffnung. (Quelle)
Mit diesen zwei Zitaten ist klar was die Zielsetzung von Hoffentlich Öffentlich im Allgemeinen und der Ansatz von Han Chon im Besonderen ist. Es geht um die Stadt als Raum der Kommunikation, in dem der Austausch von mitunter höchst unterschiedlichen Ideen geschieht und es geht um die Frage nach der Authentizität eines religiösen Symbols das im Raum des alles verwertenden Konsumkapitalismus seine traditionell überlieferte Identität verliert.
Religiöse Symbole werden karikiert (z.B. in den Mohamed-Karikaturen) oder ‚umgedreht‘ (z.B. das Kreuz im Satanismus) – alles Frevel in den Augen der Rechtgläubigen. Sie werden auch in gewissem Sinne kommerzialisiert wenn z.B. Marienfiguren in Wallfahrtsorten in Massen verkauft werden. Allerdings gibt es bei dieser Form der Kommerzialisierung einen markanten Unterschied zur Figur des Buddha. Sie findet immer  noch im symbolischen Raum der jeweiligen Religion statt. An Wallfahrtsorten oder in auf religiöse Parafernalia spezialisierten Geschäften. Die Figur des Buddha hingegen ist im Westen diesem symbolischen Raum schon längst entwichen. Man findet ihn im Baumarkt, im Einrichtungsgeschäft, in der Cafeteria, im Supermarkt, in der Werbung, als Puddingform, aufgedruckt auf Klodeckel, Bettlacken, T-Shirts, Pappbecher, Fußabtreter, zwischen Osterhasen und Barockputten in der Abteilung Gartenmöbel, als Weihnachstbaumdekoration, als Zimmerspringbrunnen, als Ökoleuchte, als Blickfang in der Werbung, im Dutzend billiger, zum Erbarmen, bis zum Abwinken. Wer hat je so etwas bei einem Jesus oder einem Mohamed gesehen – oder bei einem Buddha in den Ländern aus denen er traditionell stammt.
noch im symbolischen Raum der jeweiligen Religion statt. An Wallfahrtsorten oder in auf religiöse Parafernalia spezialisierten Geschäften. Die Figur des Buddha hingegen ist im Westen diesem symbolischen Raum schon längst entwichen. Man findet ihn im Baumarkt, im Einrichtungsgeschäft, in der Cafeteria, im Supermarkt, in der Werbung, als Puddingform, aufgedruckt auf Klodeckel, Bettlacken, T-Shirts, Pappbecher, Fußabtreter, zwischen Osterhasen und Barockputten in der Abteilung Gartenmöbel, als Weihnachstbaumdekoration, als Zimmerspringbrunnen, als Ökoleuchte, als Blickfang in der Werbung, im Dutzend billiger, zum Erbarmen, bis zum Abwinken. Wer hat je so etwas bei einem Jesus oder einem Mohamed gesehen – oder bei einem Buddha in den Ländern aus denen er traditionell stammt.
In der Figur des sitzenden Buddha werden heute bei uns die Ideen des Tauschwertes und der Erlösung unmittelbar verbunden. Einerseits wird der Buddhismus zu einem Konsumartikel, andererseits verspricht er eine erlösende Antwort auf die Probleme, die gerade aus einem sich immer schneller drehenden Konsumkarusell entstehen. Die Erlösung wird dabei immer mehr zu einem Akt in dem ein bestimmter Wert gegen ein fertiges Produkt getauscht wird. Das Gebet, die Versenkung oder ganz allgemein die geistige Übung als Formulierung einer Frage und einer Suche, finden so nicht mehr statt. Das Gebet und die Suche, jede Frage, erschöpft sich nur noch in der Produktwahl. Die Erlösung wird zur Ware. Der Priester der die Erlösung verspricht und der Gläubige der sie erwartet, geraten dabei in das Verhältnis von Produzent und Konsument. Der Gläubige kann die Erlösung erwarten wenn er den Status des Priesters anerkennt, ihn also mit seiner Anerkennung bezahlt. Der Priester gewährt als Gegenwert den Zugang zum Geheimnis der Erlösung. Das Verhältnis ist prinzipiell das des Besitzers der Produktionsmittel, zu denjenigen die lediglich ihre Produktivkraft zu verkaufen haben. Letztlich ist aber alles was stattfindet ein symbolischer Tausch, der vor allem auf gegenseitiger Anerkenntnis der Spielregeln beruht.
 Die Spielregeln brauchen jedoch einen Garanten der ausserhalb dieser Zweisamkeit existiert, da sonst der Verdacht aufkommen könnte das Ganze beruhe auf der blossen Willkür der Beteiligten. Dieser Dritte verankert den Bund der Zwei in einer scheinbar unangreifbaren transzendentalen Sphäre. Er segnet und beglaubigt ihn. Der Andere vor dessen Augen sich der Bund der Zwei abspielt, ist durch das religiöse Symbol gegenwärtig. Wir wissen wenn wir den symbolischen Tausch durchführen, daß Er gegenwärtig ist. Das Symbol erinnert uns daran.
Die Spielregeln brauchen jedoch einen Garanten der ausserhalb dieser Zweisamkeit existiert, da sonst der Verdacht aufkommen könnte das Ganze beruhe auf der blossen Willkür der Beteiligten. Dieser Dritte verankert den Bund der Zwei in einer scheinbar unangreifbaren transzendentalen Sphäre. Er segnet und beglaubigt ihn. Der Andere vor dessen Augen sich der Bund der Zwei abspielt, ist durch das religiöse Symbol gegenwärtig. Wir wissen wenn wir den symbolischen Tausch durchführen, daß Er gegenwärtig ist. Das Symbol erinnert uns daran.
Han Chon erzeugt mit seiner einfachen und genialen Installation auf dem Münchner Viktualienmarkt einen Kurzschluss in diesem System. Er lässt den Dritten im Bunde stolpern und schließlich stürzen: Er legt den Buddha flach.
Dieser Umsturz macht sichtbar wer der eigentliche Schöpfer des transzendentalen Garanten ist: der Mensch. „Made in Dresden“ heisst, daß Menschen den Buddha bauen. Darüber sollten Buddhisten in Jubel ausbrechen, denn dieser Schritt bringt sie sozusagen ins Schweben. Einmal befreit von der transzendentalen Fessel, könnten sie in einem immanenten Blitzschlag das Reale sehen – das sich zwar in seiner ewigen Iteration sofort wieder in ein neues Imago verwandelt. Aber einmal diese Bewegung zu sehen könnte Freiheit bedeuten – man sieht Bedingtes entstehen. Der umstürzende Buddha löst das X vom Buddhismus und in diesem Augenblick – wenn das X frei wird – zeigt sich die schillernde Nicht-Gestalt des reinen Potentials: Bardo.
Es ist eine Dezentrierung. Der Verlust des transzendentalen Ankers –: Das irreversible Ende der Hoffnung, daß Buddhismus die magische Zuflucht ist, die zu sein er in seiner Selbstdarstellungsrhetorik für sich in Anspruch nimmt! Eine Ernüchterung. „Das Verlassen des Hauses“. (2)
Der Zorn der X-Buddhisten
 Buddhisten sollten frohlocken, Hosianna singen und mit einer Hand klatschen. Aber stattdessen macht sich in der DBU Entsetzten und Wut breit. Das Ratsmitglied Sogen Ralf Boeck opponiert im Namen der DBU in zwei offenen Briefen, vom Mai 2013, an den Kulturreferenten der Stadt München Dr. Hans-Georg Küppers vehement gegen Han Chons gestürzten Buddha. Mit „erheblichem Befremden“ nehme man die Installation am Viktualienmarkt zur Kenntnis. Der Zorn und das Entsetzen muss so groß gewesen sein, daß im Affekt eiligst ein recht überstürzt klingender Brief aufgesetzt wurde – immerhin das offizielle Schreiben einer Institution die alle deutschen Buddhisten zu vertreten behauptet. Man erfährt zwar, daß man befremdet über die öffentliche Ausstellung und Förderung der Installation ist und das man befürchtet Angehörige religiöser Gemeinschaften könnten sie als Beleidigung auffassen, man liest schliesslich vier Fragen an das Kulturreferat, abgefasst im Stil eines strengen Sittenrichters, aber erst aus der vierten, ganz zum Schluss erfährt man – indirekt – um was es wirklich geht:
Buddhisten sollten frohlocken, Hosianna singen und mit einer Hand klatschen. Aber stattdessen macht sich in der DBU Entsetzten und Wut breit. Das Ratsmitglied Sogen Ralf Boeck opponiert im Namen der DBU in zwei offenen Briefen, vom Mai 2013, an den Kulturreferenten der Stadt München Dr. Hans-Georg Küppers vehement gegen Han Chons gestürzten Buddha. Mit „erheblichem Befremden“ nehme man die Installation am Viktualienmarkt zur Kenntnis. Der Zorn und das Entsetzen muss so groß gewesen sein, daß im Affekt eiligst ein recht überstürzt klingender Brief aufgesetzt wurde – immerhin das offizielle Schreiben einer Institution die alle deutschen Buddhisten zu vertreten behauptet. Man erfährt zwar, daß man befremdet über die öffentliche Ausstellung und Förderung der Installation ist und das man befürchtet Angehörige religiöser Gemeinschaften könnten sie als Beleidigung auffassen, man liest schliesslich vier Fragen an das Kulturreferat, abgefasst im Stil eines strengen Sittenrichters, aber erst aus der vierten, ganz zum Schluss erfährt man – indirekt – um was es wirklich geht:
Würde das Kulturreferat der Installation einer überlebensgroßen, umgestürzten Jesus- oder Marienfigur mit der Aufschrift „Made in Hongkong“ am Viktualienmarkt für fünf Monate zustimmen und diese künstlerische Aktion finanziell fördern? (3)
Dreh und Angelpunkt ist die Position des Buddha und die deutliche Markierung seines Herkunftsortes Made in Dresden. Hätte man das in einem mit Ruhe und Nachdenklichkeit achtsam verfassten Brief nicht gleich eingangs thematisieren sollen? Daß der gestürzte Buddha etwas ins Wanken bringen könnte und daß das für Gläubige Folgen hat die man nicht hinnehmen kann?
 Erst in einem zweiten offenen Brief erfährt man genau um was es wirklich geht. Der schon im ersten Brief herablassendene Ton verschärft sich nochmals deutlich und schließlich kommt die Deutsche Buddhistische Union zu Potte: Nachdem man die Nichtbeachtung der sittenrichterlichen Befragung des ersten Briefes streng gerügt hat und jedwedem Kontext der Aktion Irrelevanz attestierte, ergeht folgende Epistel:
Erst in einem zweiten offenen Brief erfährt man genau um was es wirklich geht. Der schon im ersten Brief herablassendene Ton verschärft sich nochmals deutlich und schließlich kommt die Deutsche Buddhistische Union zu Potte: Nachdem man die Nichtbeachtung der sittenrichterlichen Befragung des ersten Briefes streng gerügt hat und jedwedem Kontext der Aktion Irrelevanz attestierte, ergeht folgende Epistel:
Woran der Kontext dieser Aktion aber nicht das Geringste ändert, das ist die Tatsache, dass auf dem Viktualienmarkt unübersehbar ein religiöses Symbol im Straßendreck liegt. Ob dieses Symbol nun in Asien oder in Dresden, von einem nepalesischen Kunsthandwerker oder von Herrn Han Chong hergestellt wurde, ist dabei völlig irrelevant.
Es ist nicht der mehr oder weniger zweifelhafte Sinn dieser Aktion, der von uns kritisiert wird […] sondern das künstlerische Mittel Ihrer Ausführung; mit anderen Worten die Respektlosigkeit und die fehlende Sensibilität im Umgang mit einem religiösen Symbol […]. (3)
Die DBU versucht dann zwar den Schwerpunkt der Anklage auf die vermeintliche Verletzung der „weltanschauliche Neutralität“ der verantwortlichen Behörde zu legen, aber die Katze ist aus dem Sack. Es geht um das Symbol das nicht entsprechend der Übereinkunft zwischen Priester und Gläubigen verwendet wird. Dabei lässt seine irreguläre Verwendung bei der Verfassung der offenen Briefe einen deutlichen Affekt zu Tage treten. Die Frage ist, wieso? Der Affekt verstärkt sich in einer dritten Stellungnahme nochmals, bis hin zur offenen Konfrontation. In einem Text bei Zensplitter, Ralf Boecks Blog, sind die Verantwortlichen in München nun
Kulturbürokraten […], die künstlerisch impotent sind, aber dafür dann wenigstens ersatzweise Kunstgeschichte studiert haben […]. [Quelle]
Wenn man von solcherlei Emphase mal absieht, bleibt es aber auch in diesem Beitrag beim Kernthema:
Ein religiöses Symbol wird […] weder durch die Verfremdung (z.B. Verkitschung) noch durch eine unübliche Kontextualisierung entwertet – es ist und bleibt ein religiöses Symbol mit der ihm eigenen Bedeutung […].
Das nun ist für einen Buddhisten eine sehr interessante Behauptung. Das ist ein Essentialismus der im Mahayana mit Nagarjuna überwunden wurde. Wozu dient dieser Essentialismus? Die Antwort auf diese Frage macht auch klar warum der Sturz des Buddhas vom Viktualienmarkt einen derartigen Zorn zutage fördert.
Um was es hier geht und was deutlich macht wieso die DBU und Ralf Boeck mit einem so deutlichen Affekt reagieren, ist, daß das religiöse Symbol als Garant der transzendentalen Verankerung gefährdet ist. Gefährdet ist Die Geheime Magische Essenz. Bei ihr geht es um die fundamentale Grundlage der Institution DBU als religiöser Gemeinschaft und ihrer Gläubigen. Ohne diesen Garant würde der Vertrag, der sich gegenseitig in ihrer Funktion  bestätigenden Mitspieler, als willkürlicher, vielleicht traditionsbedingter, auf jeden Fall aber als bedingt entstehender menschlicher Akt sichtbar werden. Nur die Verankerung im jenseitigen vermeintlich nicht verletzbaren transzendentalen Raum der Erleuchtung, macht den Akt der gegenseitigen Bestätigung von Priester und Gläubigem zu einem heiligen Pakt. Wer das religiöse Symbol dieses Paktes umstürzt, die Ikone frevelt, zerstört sein Grundlage.
bestätigenden Mitspieler, als willkürlicher, vielleicht traditionsbedingter, auf jeden Fall aber als bedingt entstehender menschlicher Akt sichtbar werden. Nur die Verankerung im jenseitigen vermeintlich nicht verletzbaren transzendentalen Raum der Erleuchtung, macht den Akt der gegenseitigen Bestätigung von Priester und Gläubigem zu einem heiligen Pakt. Wer das religiöse Symbol dieses Paktes umstürzt, die Ikone frevelt, zerstört sein Grundlage.
Daher der Affekt, der Zorn, der aus den Stellungnahmen der DBU spricht: Das religiöse Symbol das den Pakt mit dem transzendentalen Buddha symbolisiert, ist das Alleinstellungsmerkmal und exklusive Produktionsmittel der DBU. Würde der Buddha tatsächlich gestürzt würde sie all ihrer Macht beraubt. Es ist also für eine Institution wie die DBU, oder auch für den Zen-Priester Sogen Ralf Boeck, von existentieller Wichtigkeit dieses Mittel nicht zu verlieren.
Fahrt zur Hölle
Han Chons Umsturz und die Reaktionen auf ihn – in ihrer gemeinsam sich entfaltenden Dynamik – machen bedingtes Entstehen sichtbar. Damit ist der Vorgang selbst ein Akt der Erleuchtung, d.h. der Einsicht in das was ist so wie es ist. Das Brandgefährliche dabei für die beteiligten x-buddhistische Institutionen ist, daß deutlich wird wie wenig man sie braucht. Er macht auch sichtbar, daß ein Symbol keinen absoluten Wert hat wie das im zuletzt genannten Zitat höchstrichterlich festgestellt wird. Letztlich macht der Vorgang sichtbar, daß X-Buddhisten eine zentrale buddhistische Einsicht abgeht:
Whatever is dependently co-arisen / That is explained to be emptiness. / That, being a dependent designation, / Is itself the middle way. (4)
Mit welchem Recht also wollen diese Leute Buddhisten vertreten? Symbole sind immer eine Konvention und haben nie eine Essenz. Das hat das 20. Jahrhunderts mit kaum zu überbietender Deutlichkeit gezeigt. Wer das religiöse Symbol immer noch als absoluten Marker versteht, das auf ein Jenseits verweist – ob Gott, Buddha, Erleuchtung, reiner Geist – gibt ein Versprechen wie es die Amtskirche oder die katholische Verachtung des Menschen schon immer gegeben hat, ohne es je einlösen zu können. Was dabei herauskommt ist keine Erlösung sondern eine Verströstung ad infinitum. Lediglich die Amtsträger sind dabei fein raus. Sie streichen den Mehrwert ein. In diesem Fall den, den der Narziss so heiss begehrt: Die Erhöhung über das gemeine Volk. Die Heiligsprechung. Das erhabene Sein jenseits der niederen Sphären der gemeinen Leute.
Wer das religiöse Symbol nicht stürzen kann, hat es nicht verdient Buddhist genannt zu werden. Wer den geheimen Vertrag aufrecht erhält, der mit diesem Signifikanten der Popen bezeichnet wird, hat es eher verdient zur Hölle zu fahren.
Der priesterliche Mummenschanz der hier sichtbar wird ist ein Rückschritt in voraufklärerische Zeiten des Absolutismus und die autoritäre Haltung die damit einhergeht ist ein Geist aus längst vergangenen Zeiten – in Verkleidung gerade des Kitsches den die Hohepriester des Abklatsches nicht entlarvt haben möchten.
Die Verkitschung, die Han Chon mit seinem gestürzten Buddha entlarvt, hat bei denen die sich so erzürnt über den Umsturz erregen schon längst stattgefunden.
Anmerkungen
(1) Zur Zeit der Abfassung dieses Textes (30.6.) firmierte Sogen Ralf Boeck als „Stellvertretender Vorsitzender der DBU“ auf der Web-Seite die den DBU-Rat vorstellt. Inzwischen (5.7.) wurde die Seite aktualisiert. In den offenen Briefen vom Mai d. J. firmiert Boeck als „Mitgleid des Rates“.
(2) Vgl. Wallis, Glenn; Nascent Speculative Non-Buddhism, S. 12: Ancoric loss.
(3) Zwei offenen Briefe der Deutschen Buddhistischen Union an Dr. Hans-Georg Küppers, Kulturreferat der LH München: 21.5.2013 [Pdf] und 29.5. [Pdf]. Antwort vom 23.5. [Pdf] des Münchner Kulturreferats auf den ersten offenen Brief der DBU.
(4) Nagarjunas Mūlamadhyamakakārikā; XXIV, 18; in der Übersetzung von Jay Garfield.
Brief des Münchner Oberbürgermeisters [Pdf] Christian Ude an das Königlich Thailandische Honorargeneralkonsulat. Ude stellt fest:
Die liegende Buddhaskulptur auf dem Viktualienmarlt ist […] kein Ritual- oder Kultgegenstand, sondern Han Chons kritischer Kommentar zur beliebigen Verwendung eins religiösen Symbols.
Protestflyer [Pdf] der Interessengemeinschaft München gegen „Made in Dresden„.
Alle Fotos und Bearbeitungen © Matthias & Bettina Steingass; außer: „Made in Dresden“ © Wolf Graebel.

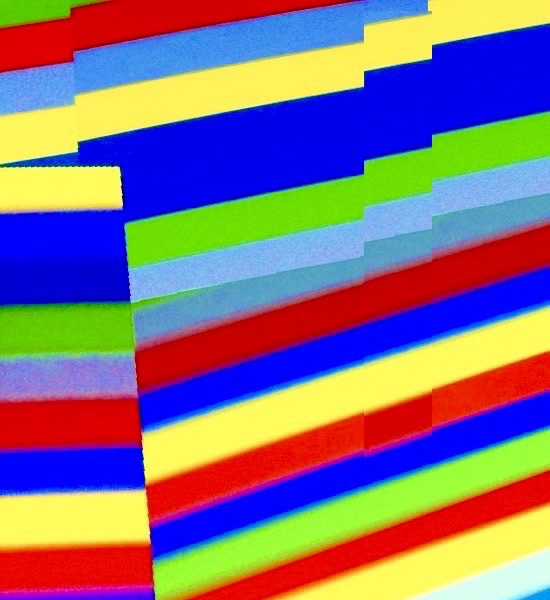


Toll! Aus meiner Sicht Dein bislang bester Beitrag! Danke. In Kürze ein paar mehr Worte…
Hallo Matthias
Eine sehr interessante, sehr inspirierende Glosse! Ich stimme Joachim voll bei.
Ich verstand Han Chons Installation auf Anhieb als Protest gegen die hier im Westen nun auf dem Höhepunkt angelangte Kommerzialisierung des Menschen Siddhartha Gautama Buddha und seiner hinterlassenen Lehre (= Empfehlungen fürs Leben …). Da hat es ein Künstler gewagt, diesen Buddha einfach „umzulegen“, auf den Rücken, auf eine Marktstrasse. So was! So einfach! Das hat meiner Meinung nach rein gar nichts mit Blasphemie zu tun.
(Man erinnere sich doch nur mal an die vielen deftigen und treffenden Aussprüche all der alten chinesischen und japanischen Zenmeister …).
Dass die Vor- und Hintersitzenden des DBU dies nicht verstehen, darüber kann man nur den Kopf schütteln. Durch ihre Reaktion laufen sie Gefahr, sich zum Anwalt des unerträglichen Buddha-Kommerzes zu machen, den sie persönlich in ihrem privaten Leben, wie ich nun annehmen möchte, wohl kaum praktizieren und gutheissen können. Man kann ihre öffentliche Intervention nur als einen erbärmlichen Reflex bezeichnen, bekannt aus längst vergangenen Zeiten, – ex cathedra halt.
Gruss
Guido
All die Vogelscheisse auf dem Steinbuddha.
Recht so.
Ich schwenke meine Arme wie Blumen im Wind.
Ikkyu Sojun, (Zenmeister, 1394-1481)
Auch ganz unterhaltsam zu lesen: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/aerger-ueber-kunstaktion-am-viktualienmarkt-buddha-bewegt-1.1679470
Inklusive professioneller Betrollung durch das Kulturreferat :)
… Irgendwie sollten wir einen Weg finden zwischen „Mit dem Buddha kann alles machen“ und „Mit dem Buddha kann man eben nicht alles machen“ …
„Herr Steingass hat – wie fast immer – einiges Bedenkenswerte zu sagen. Deswegen ist sein Blog hier auch verlinkt. Er schiesst allerdings auch hier wie sonst in seinem eifernden Polemisieren gegen ‚X-Buddhisten‘ weit über das Ziel hinaus. So ist das mit der „geheimen magischen Essenz“ des religiösen Symbols als „Garant der transzendentalen Verankerung“, über die er da flott drauflosfabuliert, schlichter Blödsinn. Das Abbild Buddhas symbolisiert das Zufluchtsobjekt Buddha – damit den Zustand, den jeder Buddhist, wenn er seine Zufluchtnahme denn ernst meint, anstrebt. Nicht mehr und nicht weniger. Daran ist nichts „Geheimes“ und nichts „Magisches“ – und „essentiell“ ist dies lediglich in Hinsicht der Ausrichtung buddhistischer Praxis. Gänzlich aus der Kurve trägt es Herrn Steingass mit seiner These „transzendentaler Verankerung“. Da verwechselt Herr Steingass wohl das christliche Verständnis der Priesterweihe (sacramentum ordinis) mit dem der buddhistischen Priesterordination (tokudo 得度), die im Übrigen eine Spezialität japanischer und einiger koreanischer Traditionen ist. Wenn es da um eine „Verankerung“ geht, dann um eine in der Praxis. Wenn Herr Steingass tokudo für eine „transzendentale Verankerung“ hält, dann weiss er schlicht nicht, wovon er redet bzw. schreibt. Und nicht nur da. Da werden abendländische Konzepte mit einer jahrhundertealten, durch christliche Theologie geprägten Begriffsgeschichte undifferenziert auf nur oberflächlich verwandt erscheinende Konzepte übertragen und das dann polemisch ausgebeutet. Das ist – vom polemischen Missbrauch abgesehen – eine der Empirie verhaftete vergleichende Sichtweise auf Religionen, die auf dem Stand der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts (Durkheim, Mauss) stehen geblieben ist. Sie bleibt an der Oberfläche und verweigert sich einem wirklichen Verstehen, ist dazu durch die Verweigerung eines ernsthaften hermeneutischen Ansatzes auch gar nicht fähig. Das ist das wesentliche Symptom der Krankheit des von Herrn Steingass propagierten „Unbuddhismus“. Eine Synthese buddhistischen Denkens mit abendländlischen empiristischen und rationalistischen Ansätzen ist das nicht und kann es mangels Fundierung auch nicht werden.
Um nur noch auf einen weiteren – nachrangigen – Punkt von Herrn Steingass‘ Analyse einzugehen: Wenn er schreibt: „die Figur des Buddha hingegen ist im Westen diesem symbolischen Raum schon längst entwichen“ dann ist auch dies blanker Unsinn. Symbole sind häufig polyvalent, es sei hier nur beispielhaft auf die Swastika verwiesen. Auch, wenn ein Großteil der deutschen Gesellschaft ein Abbild Buddhas lediglich als vage spezifiziertes Signal für Wellness, Entspannung, Gelassenheit, Exotismus oder was auch immer sehen mag – ein kleiner Teil der deutschen Gesellschaft versteht dieses Symbol immer noch genau so, wie es vor seiner Kommerzialisierung gemeint war. Ein religiöses Symbol wird nicht durch Missbrauch entwertet, es wird eben nur missbraucht – und schon gar nicht „entweicht“ es selbst irgendwelchen „symbolischen Räumen“. Es kann von denen, die es als Sinnbild eines religiösen Kerngedankens verstehen, als Symbol aufgegeben werden, weil es durch fortgesetzten und verbreiteten Misssbrauch missverständlich wurde. Das ist aber bei dem Symbol der sitzenden Buddhafigur nicht in Sicht, wie gerade die Proteste gegen ‚Made in Dresden‘ zeigen. Die Deutungshoheit (keine allgemeine, sondern eine ‚für sich‘) über das Symbol ‚Buddha‘ ist auch in Deutschland von den ‚X-Buddhisten‘, wie sie Herr Steingass nennt, nicht auf- oder abgegeben worden – und nehmen kann sie ihnen niemand, auch kein ‚Unbuddhist‘ wie Herr Steingass.“
Herzliche Grüße,
SoGen
Guter Artikel.
Das Problem ist aber, die X-Buddhisten sind intellektuell schlicht nicht satisfaktionsfähig, heißt: man würde am liebsten bloß abwinken, macht ihr halt – wenn es einen nicht so jucken tät.
Immerhin liefert Herr SoGen, wo immer er diese Replik ursprünglich geschrieben haben mag, aber noch ein vieldeutiges Wort, von der Krankheit es Unbuddhismus ist da die Rede, das ist doch interessant.
Hallo Leute, danke für eure Beiträge. Habe ein paar Tage mit der Erforschung der Immanenz Südtiroler Weine verbracht. Komme morgen/übermorgen auf eure Beiträge zurück…
Ein Zitat von mir aus einer Münchner Stadtteilzeitung:
„Für mich als deutscher Buddhist bedeutet diese städtische Entscheidung [die Kunstaktion nicht frühzeitig zu beenden] aber ein glückliches Ende einer sonst eher enttäuschenden Geschichte. Meines Erachtens haben die Buddhisten mit dieser Aktion nämlich eine einmalige Chance verpasst, sich erkennbar von anderen Glaubensgemeinschaften abzuheben. Stattdessen haben sie leider genauso reaktionär gehandelt wie jede andere religiöse oder sonstige Lobbygruppe auch. Zwar hat die DBU natürlich recht, dass z.B. eine ähnlich große, umgestürzte Jesusfigur – ganz zu schweigen von einem irgendwie geschändeten Mohammed – nicht von der Stadt genehmigt worden wäre bzw. einen Aufschrei ohnegleichen verursacht hätte. Allerdings bedeutet das längst nicht, dass solch beleidigte Empörung berechtigt ist und sogar von angeblich aufgeklärten Buddhisten nachgeahmt werden muss. In einer demokratischen Gesellschaft gehört Kritik an den Religionen ja genau so dazu wie jede andere freie Meinungsäußerung. Aber vor allem hat in diesem Fall die Buddha-Statue, wie der Künstler ja auch betont, sowieso überhaupt keine religiöse Bedeutung, sondern steht stellvertretend für die Vermarktung und Globalisierung von vermeintlich „echtem” Kulturgut. Eigentlich sollten die meisten Buddhisten ja völlig hinter einer solchen Kunstaktion stehen, geht es doch um die Ausbeutung von ihrem eigenen Heiligtum als Touristen-Kitsch. Leider gelangen wohl die wenigsten zu dieser Einsicht; glücklicherweise hat aber die Stadt genug Mut gezeigt, die Beleidigung einzelner Touristen und Gläubigen in Kauf zu nehmen, um die künstlerische Freiheit in diesem Fall zu bewahren. Buddha sei Dank!“
Zur Antwort von SoGen Ralf Boeck DIE GLOSSE #06.
Grundsätzlich geht es hier um eine Auseinandersetzung mit der DBU nicht mit Herrn Boeck. Hätte Herr Boeck seinen Unmut über den Buddha vom Viktualienmarkt privat und nicht im Namen der DBU geäussert, hätte ich darauf nicht reagiert. Ich hätte wahrscheinlich die Texte nicht mal mehr als oberflächlich zur Kenntnis genommen.
Boeck versteht nicht, um was es überhaupt geht. Das wird aus seiner Antwort unmittelbar deutlich. Es geht z.B. nicht um einen „der Empirie verhaftete vergleichende Sichtweise„. Wahrscheinlich kommt er darauf durch den Begriff „Immanenz“ der im Text eine wichtige Rolle spielt. Wenn er verstehen würde was mit dem „transzendentalen Anker“ gemeint ist, würde er auch verstehen wie Immanenz gemeint ist. Der transzendentale Anker ist dafür verantwortlich wie wir empirisch wahrnehmen. Es geht also nicht um einen gedankenlose Empirie sondern gerade um die Frage, was unsere Wahrnehmung bzw. Erkenntnisfähigkeit formt und beeinflusst.
Boecks transzendentaler Anker wird aus dieser Äusserung in seiner Antwort deutlich:
„Das Abbild Buddhas symbolisiert das Zufluchtsobjekt Buddha – damit den Zustand, den jeder Buddhist, wenn er seine Zufluchtnahme denn ernst meint, anstrebt. Nicht mehr und nicht weniger.“
Das Problem hier ist, daß zwar von einem Symbol die Rede ist das auf einen erstrebenswerten Zustand verweist – Symbol ⇒ Zustand – um was es aber eigentlich geht, kommt nicht zur Sprache. Die Definition dessen um was es geht ist tatsächlich zirkulär. Sie besteht aus nur zwei Komponenten – Symbol ⇔ Zustand. Um zu verdecken, daß es sich um einen zirkuläre, zweipolige, von Menschen geschaffene, geschichtliche, also bedingt entstandene Definition handelt, wird der transzendentale Anker benötigt. Der zeigt sich z.B. im Verweis auf die „Ausrichtung buddhistischer Praxis“ wie Boeck weiter schreibt. Aber sagt uns das tatsächlich mehr? Macht es das klarer? Nein. Es wird auch nirgendwo klarer werden. Ausser wir machen den vollen Kreis bis wir wieder am Ausgangspunkt ankommen und sagen, daß es lediglich um das Leben geht, um tätig sein, um materielle Handlung. Das Schwierige dabei ist, daß diese Immanenz immer transzendental präfiguriert ist. Es geht also nicht um die Abschaffung des Ankers sondern um seinen Bewusstmachung und bewusste Verschiebung. Diesem Prozess verweigern sich die DBU bzw. Boeck in ihrer platten affektiven Ablehnung der Problematik die durch die Kuratoren und den Künstler thematisiert wird. Der Grund ist, daß der transzendentale Anker – Boecks ominöser „Zustand“ (das Signifikat = die Sache, auf die der Signifikant als Ausdruck verweist) – das Alleinstellungsmerkmal ist, über das allein das Produkt seinen Wert erhält. Das Produkt ist nicht etwa Erleuchtung im Sinne von Verständnis dessen was Bewusstsein formt, sondern soziale Zugehörigkeit und Anerkennung. Da es sich aber um eine reine Zugehörigkeit ohne erkennbaren Effekt handelt – man widersetzt sich gerade der Erkenntnis darüber was Bewusstsein formt – handelt es sich um eine narzisstisches Unternehmen in dem Zugehörigkeit allein dazu dient mangelndes Selbstwertgefühl aufzuwerten.
Es geht beim transzendentalen Anker auch nicht um eine Transzendenz, also um einen wie auch immer geartetes größeres Ganzes in dem unsere Immanenz eingebettet ist. Es geht auch nicht um „tokudo„. Das zu unterstellen, um dann zu behaupten ich wüsste nicht von was ich rede, ist ein dummer kleiner rhetorischer Trick der die Ebene zeigt auf der X-Buddhisten gerne spielen. Unterstellung, Verdrehung, Diffamierung, Verunglimpfung, die ganze Bandbreite kleinbürgerlicher Spiessigkeit kommt einem da entgegen. Bis hin zu der Bemerkung von der „Krankheit des von Herrn Steingass propagierten „Unbuddhismus„. Wenn der Andersdenkende als „krank“ bezeichnet wird, dann ist das tatsächlich nicht mehr satisfaktionsfähig. Das ist einfach nur unter aller Sau.
Hier wird allerdings ein Problem deutlich von dem mir scheint, daß man mehr Augenmerk darauf richten sollte: Die reaktionäre und autoritäre Haltung vieler Buddhisten. Bei Boeck wird die aus seinen Bemerkungen darüber deutlich, daß sich der Künstler gefälligst absolut verständlich zu machen habe:
„Wenn [Kunst] jedoch falsch verstanden wird, dann hat der Künstler versagt, dann hat er etwas falsch gemacht. Er hat nicht das Recht, vom Rezipienten zu fordern, er möge das Werk doch bitteschön so verstehen, wie er es gemeint hat.“
Wenn jede kreative Äusserung und Neuerung auf eine allgemeines „Ja“ von Rezipienten wie der DBU und Boeck angewiesen wären, gäbe es nur Stagnation. Wenn Wagnerianer Schönberg, Romantiker Kubisten, die Funk- und Diskomusiker der 70er die Punkrocker oder ‚Buddhisten‘ wie Boeck jeden neuen Gedanken der mit Buddhismus zu tun hat zu bestätigen hätten, würden wir noch immer mit einer Handvoll Beeren in einer Höhle hocken.
Das Andere als „krank“ zu bezeichnen und darauf zu bestehen, daß der Künstler sich dem allgemeinen Geschmack anzupassen habe, verweist möglicherweise auf eine politische Haltung von der ich lieber nicht allzu viel wissen will. Aber es ist das Problem der DBU und des deutschen Buddhismus allgemein, daß solches reaktionäres Bewusstsein hier einen Platz findet.
Die zuletzt genannte Bemerkung von Boeck verweist auch dadurch auf seine autoritäre Haltung, indem sie davon spricht, etwas sei so zu verstehen wie es „gemeint“ ist. Das Gemeinte aber entsteht nur in der Kommunikation und Interaktion, nicht in einem einsamen Akt des Meinens. Gerade der Kommunikation aber verweigern sich DBU bzw. Boeck. Boeck stellt eine autoritär in den Raum gestellte Bedeutung eines sitzenden oder liegenden Buddha gegen eine dem Künstler unterstellte Behauptung. Dabei entsteht aber tatsächlich die Bedeutung des liegenden Buddha vom Viktualienmarkt gerade in der Interaktion der Beteiligten. Das ist die Hermeneutik die da stattfindet. Das aber ist Boeck überhaupt nicht bewusst, bzw. er verweigert sich genau diesem hermeneutischen Akt.
Die DBU versucht de facto eine Diskussion zu verhindern. Das ist das Problem. Und der Grund dafür ist immer, daß das Alleinstellungsmerkmal der X-Buddhisten vor die Hunde gehen könnte.
Noch zwei, drei kurze Bemerkungen.
Die Themen Hermeneutik und Transzendentaler Anker sind sozusagen ’schichtenmässig‘ angesiedelt. Die Hermeneutik ist dabei die weniger tief gelegene. Hermeneutik ist die Frage Was bedeutet es? Das Transzendentale bestimmt überhaupt, was wir wissen können. D.h. es geht um die Frage, wie unser Erkenntnisprozess überhaupt strukturiert ist. Was können wir innerhalb dieser oder jener Struktur erkennen?
Meine im Text verstreuten christlichen Töne sind dabei mit Absicht gesetzt. „Bund“ z.B.: Dabei denke ich an den Neuen Bund zwischen Christus und seinen Jüngern. Das hat nichts damit zu tun, daß ich christliche Denkmuster unreflektiert auf fernöstliche Philosophie projiziere, sondern es soll ein Hinweis darauf sein, daß unser buddhistisches Denken tief von christlich-abendländischen Strukturen durchdrungen ist, ohne daß das vielen Buddhisten auffiele. Vgl. hierzu etwa Die Suche nach einem »Buddhismus im Westen« als postkoloniales Projekt – ein echtes Highlight in der aktuellen Buddhismus aktuell (3/2013).
Ein Beispiel für eine christlich-abendländische Struktur ist das Muster Ursprünglich-Niedergang-Rückkehr zum Ursprung. Das ist eine Tiefenschicht die hiesiges buddhistisches Denken häufig strukturiert und die dem Muster Paradies-Sündenfall-Erlösung entspricht. Das böse „Ego“, von dem im Buddhismus häufig die Rede ist, und das „reine Bewusstsein“ zu dem man gelangen will, entsprechen dabei dem gefallenen Menschen und dem Reich Gottes. Darüber gibt es einige (englischsprachige Arbeiten), das ist also keine an den Haaren herbei gezogene Behauptung.
An diese das Denken strukturierende Tiefenschicht kann man nicht über Hermeneutik heran, also über die Frage Was bedeutet es? Sondern nur über die Epistemologie, also über die Frage Was kann ich überhaupt wissen?
Im Fall der Inkulturation des Buddhismus im Westen muss man dazu beispielsweise die historischen Prozesse sichtbar machen die zeigen, wie sich Kulturen gegenseitig beeinflussen. Der oben genannte Artikel ist dabei schon mal sehr hilfreich.
Für Praktizierende heisst das nicht, daß sie ein Universitätsstudium nachholen müssen, sondern daß man sich damit zufrieden geben muss nur über lokales Wissen zu verfügen dessen Quellen evtl. unsichtbar bleiben. D.h. u.a. man muss auf jede verallgemeinernde Aussage bzw. auf jeden Universalismus verzichten.
Ein höchst beliebter Universalismus, ein transzendentaler Anker par excellence sozusagen, ist – Tusch! –: Der Zeitlose Dharma. Er findet sich in der aktuellen Buddhismus aktuell bei Ralf Boeck (S. 27, vorletzter Absatz) und bei Alfred Weil (S. 61, im ersten Abschnitt Säkular – Seine Demontage 2.0, eine Retourkutsche gegen Batchelor, ist übrigens eine prima Selbstdemontage). Auch Hans Gruber ist ein großer Fan des „zeitlosen Dharma“.
Über diesen nebulösen zeitlosen Dharma müsste man einen ganzen Aufsatz schreiben, angefangen bei der sterotypen Übersetzung von akalika mit „zeitlos“.
Hier ein Video über die Aussstellung A Space Called Public / Hoffentlich Öffentlich. Han Chons Made in Dresden findet sich ab Minute 3:15. Direkt anschliessend geht es um eine Installation von Martin Kippenberger der 2008 einen riesen Skandal in Bozen auslöste (posthum, aus dem Grab). Der Stein des Anstoßes war Zuerst die Füsse – ein ans Kreuz genagelter Frosch.
Eigentlich sollte die DBU froh sein, daß Kippenberger schon lange tot ist. Was der mit dem Buddha gemacht hätte… nicht auszudenken.
Ich kann gerade nur kurz kommentieren. Gehe doch mal bitte einer hin auf den Viktualienmarkt und schlage der Buddhafigur eine Axt ins Holz, auf der steht: „Wenn du den Buddha triffst, toete ihn.“ Das ist Zen, und nicht, was Sogen da aufgrund seiner „Zufluchtnahme“ projeziert.
Den liegenden Buddha gibt es ausserdem ueberall auf der Welt …
Ich erinnere hier an „Das Gespenst“ (unter diesem Titel auch in Wikipedia zu finden), dem blasphemischen Film Herbert Achternbuschs, wo Jesus in einer Szene als „Scheisse“ angesprochen wird. Dies u.a. fuehrte zu heftigen Kontroversen. Als Zenbuddhist habe ich mich darueber am meisten amuesiert, denn so wurde der Religionskrieg (den manch einer der Buerokraten natuerlich klammheimlich doch in Muenchen inszeniert sehen mag) ad absurdum gefuehrt: „Was ist Buddha? – Der Spachtel fuer die Scheisse.“
Ich darf auch vielleicht anmerken, dass der Protest vor der deutschen Botschaft in Bangkok keineswegs als Zeichen verstanden sollte, dass Buddhisten weltweit gegen das Projekt stehen. Im Gegenteil ist Bangkok bloß der Hauptsitz des „World Fellowship of Buddhists“, dessen Vize-Präsident bekanntlich Rudolf Döring, Ehrenrat der DBU, ist.
Apropos Thailand … In meinem Asso-Blog habe ich kuerzlich auf die neuesten Skandala unter thailaendischen Moenche hingewiesen, die reichen wirklich querbeet von illegalem Sex ueber Drogengeschaefte bis zum Wetten. Es ist also schon ein Witz, wenn die sich da so weit rauslehnen. Sogen erwaehnt u.a. auch die Berichterstattung auf dem Kanal von DMC, die ich fuer eine der gefaehrlichsten Sekten im Lande halte (ihr Anfuehrer wurde auch schon wegen finanzieller Delikte angeklagt). Der Duennschiss, den die hier als Buddhismus verbreiten, wuerde Matthias eine Dauermigraene einbringen.
Christopher und GuiDo, danke für die zusätzlichen Informationen.
Es gibt ein paar Aspekte bei dieser Geschichte, die ich ziemlich bedenklich finde.
Von den beiden aktiven deutschen buddhistischen Foren weiss ich wie fundamentalistisch Buddhisten oder solche die sich dafür halten argumentieren können. Ich habe es weitgehend aufgegeben auf dieser Ebene zu diskutieren. Nun stelle ich mit Erstaunen fest, daß (zumindest in Teilen) die DBU auf der gleichen Ebene argumentiert.
Merkmale dieser Form von Debatte sind z.B.: ad hominem, Informationsverzerrung und Ablenkung vom eigentlichen Thema.
Ad hominem (also die Person abwerten anstatt sich mit dem Argument zu befassen) findet man bei Boeck einige Male. Z.B. „impotente“ Münchner Kulturpolitiker oder „kranke“ unbuddhistische Auffassungen.
Informationsverzerrung findet da statt wo die Intention des Künstlers systematisch ausgeblendet wird.
Ablenkung vom eigentlichen Thema findet dort statt, wo man, wie Boeck in seinem letzten Kommentar, darauf beharrt, daß es um ein juristisches Problem geht, anstatt darum, daß hier ein exklusives Symbol in seiner Zweideutigkeit (Kitsch/Kommerz und Religion) entlarvt wird.
Daß das alles von einem Rat der DBU kommt, naja…
Ein weitere Punkt sind die anscheinend sehr schwierigen Verhältnisse im DBU-Vorstand. Man vergleiche dazu den Bericht zur letzten Mitgliederversammlung im April im aktuellen Buddhismus aktuell (S. 72 f).
Das alles und die ganze Affäre machen eine konservative und verhärtetet DBU sichtbar, die noch dazu recht schwach und entschlussunfähig zu sein scheint.
Nimmt man noch beispielsweise das von der DBU allen Mitgliedern abverlangte Glaubensbekenntnis hinzu – das voll ist mit dem was ich oben im Text als „transzendentale Anker“ bezeichnet habe – wird eine Institution sichtbar die alles andere als modern ist, vielleicht sogar antimodern.
Antimodern, konservativ, verhärtet und schwach. Soll das der Dachverband sein, der deutsche Buddhisten repräsentiert?
Ich frage mich, ob progressive Kräfte das DBU-Treffen im Oktober nicht nutzen sollten um sich zu treffen, kennen zu lernen und sich ihrerseits mehr zu organisieren? Das Treffen ist überschrieben Treffen – Kennenlernen – Austauschen – Einladung zum innerbuddhistischen Dialog.
Also, geht da nur mal hin, zum DBU-Treffen, ich selbst werde da nicht im Lande sein. Immerhin habe ich aus der Redaktion von Buddhismus Aktuell die Zusage fuer den Abdruck eines Leserbriefes, der gegen Batchelor wettert, fuer mich schon mal ein gutes Zeichen. Ich lese ja aus dem Magazin fast nur noch, was kostenlos im Netz steht, es ist also begruessenswert, wenn Du die Entwicklung der Texte dort weiterverfolgst, mit Frau Richard koennte ein neuer Wind wehen.
Meines Erachtens ist es wegen der Kluengelei in der DBU besser, eine Alternativorganisation zu gruenden, so man eine fuer noetig haelt. Als Herbert Rusche noch im Rat war (eine „Amtszeit“, er war ihnen wohl zu progressiv), sagte er mir, Aktionen wie die einstige Presse-Erklaerung gegen Stammzellenforschung gingen jedoch meist von Einzelnen aus. So ist die letzte wohl vor allem auf Sogens Mist gewachsen, wofuer auch der Duktus spricht. Ich zweifle etwas an Sogens Uebersicht ueber das deutsche Recht, er hatte schon damals im Fall des Skandals in der Pagode Phat Hue eher defensive Massnahmen herausgepickt, die – wie im Uebrigen auch die letztendliche Beseitigung des DBU-Forums (Facebook ist ja nicht mehr das Gleiche) – eher wieder dazu beitragen, die Dinge in Vergessenheit geraten zu lassen. Jedenfalls wird im Fall der Kunstauktion viel geredet, zu einer Klage kommt es aber offensichtlich nicht. Wenn man ueberlegt, die DBU habe damals beim Dalai Lama-Event wissentlich mit einem korrupten Berobten kooperiert – was ist dann schon ein liegender Buddha auf dem Viktualienmarkt, der immerhin den Lotossitz beibehaelt, gegen einen liegenden Moechtegernbuddha ohne Unterhose?
Es ist richtig, dass Sogen die Neigung hat, insbesondere Menschen, die er als „Neulinge“ im Buddhismus einstuft (d.h. noch nicht gut genug kennt) herunterzuputzen. Ich habe kuerzlich eher zufaellig beim Googeln nochmal eine recht alte Replik auf mich gefunden, die ich unter einem Pseudonym verfasst hatte, und da ging es tatsaechlich auch wieder so los, wie er mir einst (namentlich erkennbar) im DBU-Forum begegnet war, nach dem Motto: „Aber ob du schon in der Lage bist, das beurteilen zu koennen …“ In einer Replik, die noch heute fuer mich gilt, habe ich ihm einst seinen Zitaten- und Textewust vorgewurfen (auch wenn sachliche Informationen wichtig sind) und einen Mangel an eigener Umsetzung seiner sicher recht intensiven Meditationspraxis. Sogen hat etwa durch seine Argumentation gegen die Organspende den konservativen Kurs der DBU unterstrichen. Was seine Raserei gegen die Kunstaktion angeht, so schlaegt da ein leider verbreitetes Phaenomen unter Buddhisten durch, eine ungeheure Skepsis gegenueber jeder Kunst und Literatur, die nicht zur buddhistischen Ueberlieferung gehoert. Es gibt ja sogar Lehrer wie Thich Nhat Hanh (und auch klassische, „authentische“ Zenlehrer), die von der Lektuere von Romanen abraten. Erschreckend, wenn sich Buddhisten im obigen Fall aehnlich gebaerden wie Muslime beim Anblick von Mohammed-Karrikaturen.
Zu bedenken ist auch, dass einige DBU-Ratsmitglieder politisch eine klare Tendenz zeigen und insgeheim auch von parteipolitischen oder ideologischen Erwaegungen getrieben sein koennten.
Hallo GuiDo.
Betreffend Aktionen einzelner im DBU-Rat: Wenn es eine abgestimmte Aktion des Rates gewesen wäre, hätte wohl Frau Hilpert in München die offenen Briefe nicht mit „i.A. für Ralf Boeck“ unterzeichnet. Daß Einzelne derart öffentlichkeitswirksame Aktionen im Name einer Institution durchsetzen können die laut Satzung für die „Gemeinschaft der Buddhisten in Deutschland“ spricht, zeigt, daß Einzelne in dieser Institution ihr höchst subjektives Süppchen im Namen all dieser Buddhisten kochen können. Das ist unprofessionell und macht die DBU dubios.
Was die „ungeheure Skepsis gegenüber jeder Kunst und Literatur“ angeht: Da zeigt sich bei Boeck nicht nur Skepsis sondern eine frappante Ahnungslosigkeit. Eine die aber nicht nur für ihn typisch sein dürfte. Das was wir X-Buddhismus nennen zeichnet sich dadurch aus, daß er alles ausserhalb des Dharmas ignoriert. Wobei „Dharma“ eine völlig unreflektierte Kategorie ist, die bei genauer Betrachtung keineswegs „zeitlos“ ist, sondern geprägt von unbewussten Reflexen und kulturell bedingt entstandenen Bewusstseinsstrukturen.
X-Buddhismus wird so zu einem Schutz des Narzissten vor Einsicht in die Strukturiertheit und Bedingtheit des Ichs.
Konkret zeigt sich Boecks Ahnungslosigkeit über Kunst darin, daß er nicht sieht wie die Bedeutung dieses Kunstwerkes nicht aus sich selbst heraus entsteht, sondern aus der Interaktion der Menschen mit ihm.
Konkret zeigt sich Boecks Ahnungslosigkeit auch darin, daß er annimmt, der religiöse symbolische Wert der Figur eines sitzenden Buddhas habe nichts mit dem kommerziellen symbolischen Wert eines sitzenden Buddhas im Baumarkt zu tun.
Beides ist philosophisch naiv und zeigt, daß, obwohl er das Wort Hermeneutik kennt und benutzt, er nichts von seiner Bedeutung versteht.
Auch hier wieder gilt: Eine Institution die für eine Gemeinschaft spricht deren erklärtes Ziel es ist, Bedingtes Entstehen sehen zu wollen, dann aber von derartigen Privatverzerrungen geprägt wird, ist dubios.
Betreffend „Alternativorganisation und DBU-Treffen „: Mir persönlich liegt nichts ferner als die Gründung einer Organisation. Ob ich zu dem Treffen gehe, wird davon abhängen was dort tatsächlich laufen soll. Bis jetzt klingt es wie ein gute Idee, die, wenn sie von der DBU programmiert werden sollte, garantiert nichts bringt. Das bringt nur was, wenn die DBU zeigt, daß sie tatsächlich Freiraum bietet und nicht Bevormundung wie in der Affäre mit dem liegenden Buddha.
Ich habe aber Zweifel ob dieses Tagung der richtige Ort ist für Leute mit einem kritischen Geist. Die Tagung ist als „intern“ deklariert, die sich „von ihrer Themenwahl in erster Linie an Buddhisten und Mitglieder der DBU richtet, die sich für den innerbuddhistischen Dialog interessieren“.
Interessant wäre es nur wenn man wüsste, daß das frische Lüftchen, das mit Frau Richard weht, auch tatsächlich als Frischluftzufuhr gedacht ist. Bitter nötig hätte es der miefige deutsche Buddhismus allemal.
Als Dresdner frag ich mich: Wieso eigentlich Made in Dresden? Hier gibt es doch kaum Buddhisten. Schliesslich gelten ja Ostdeutschland (und Tschechien) nicht ohne Grund als Religionsunanfällig.
(Nebenbei gesagt halte ich SoGen für einen der wenigen in der DBU, die man ernst nehmen kann).